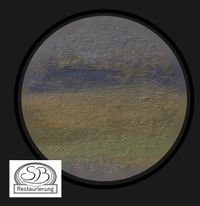2025-07-04
Neben der Ausbildung an Akademien und im Privatunterricht suchten Kunstschaffende um 1900 aktiv den Austausch in Künstlervereinen und -gruppen, auf Ausstellungen und bei Atelierbesuchen. Studienreisen boten eine besondere Gelegenheit, um neue Arbeitsweisen kennenzulernen. So entstanden weit verzweigte Netzwerke, oft über Ländergrenzen hinweg. Häufig reisten befreundete Künstler*innen gemeinsam. Und überall, wo sie zusammenkamen, wurde diskutiert – mit viel Glück für die heutige Forschung auch über die verwendeten Materialien.
Der Historienmaler Hermann Prell pflegte ein umfangreiches Netzwerk und dokumentierte nicht nur seine eigenen Rezepte, sondern auch die anderer Künstler. Für die kunsttechnologische Forschung sind solche schriftlichen Überlieferungen oft zentrale Quellen, die durch erhaltene Werke ergänzt werden. Die gemeinsamen Reisen von Hermann Prell und Georg Müller-Breslau ermöglichen es, am Beispiel ihrer Künstlerfreundschaft größere Zusammenhänge aufzuzeigen.
Künstlerfreunde unterwegs
Hermann Prell lernte seinen Freund Georg Müller-Breslau während seines Studiums an der Berliner Kunstakademie kennen. Die beiden malten häufig in der freien Natur. In seinen Memoiren beschreibt Prell ihre Reise nach Hain (heute Przesieka in Polen) im Jahr 1883, bei der sie begannen, auf dunklen Pappen zu malen. Das Rezept für die von Müller-Breslau verwendete Leimung, die aus starkem Leim mit einigen Tropfen Tusche bestand, ist in Prells Notizbuch überliefert. Doch das Vorgehen lässt sich nicht nur in den Schriftquellen nachvollziehen, sondern auch an den erhaltenen Ölstudien.
Untersuchung der Studien
Die Untersuchung von Prells dunkel isolierten Ölstudien auf Papier und Pappe zeigte zwei Leimschichten: eine transparente und eine dunkel gefärbte. Im Querschliff einer mikroskopischen Probe lassen sich die Schichten anhand ihrer UV-Fluoreszenz deutlich unterscheiden.
Selbst als erfahrener Maler trug Prell die Leimung in einigen Fällen zu stark auf, sodass es zu Rissen, dem sogenannten Craquelé, mit Abhebungen und Fehstellen kam. An einer Studie, die während dieser Reise entstand, traten die Schäden bereits zu seinen Lebzeiten auf. Die Verluste retuschierte er selbst.
Warum ein dunkler Malgrund?
Laut Hermann Prell erleichtert ein dunkler und leicht streifiger Untergrund die schnelle Erfassung der Motive, auch an Stellen, an denen die Farbe dünn aufgetragen wurde. Die Studien zeigen vor allem Landschaften. In den dunklen Partien, wie Felsformationen und Schatten, genügten wenige Pinselstriche, um den gewünschten Eindruck zu erzeugen. Durch den dünnen Farbauftrag im Himmel entstanden atmosphärische Effekte.
Dunkle Untergründe galten damals als Wiederbelebung der Grundierungen der Alten Meister. Diese Idee verbreitete sich in Künstlerkreisen und wurde individuell weiterentwickelt.
Solche Beispiele zeigen, wie eng persönliche Netzwerke und technisches Wissen miteinander verknüpft sind und wie wichtig es ist, beide Ebenen in der Forschung gemeinsam zu betrachten.
Literatur: Silke Beisiegel: „Ich verfolgte damals alle malerischen Mittel“ Kunsttechnologische Forschungen zum Werk des Historienmalers Hermann Prell (1854–1922), online.

Silke Beisiegel - 17:01 @ Material und Technik, Untersuchung